Um das Wohlbefinden und die Ressourcen messen zu können, behandelt die UWE-Befragung fünf thematische Dimensionen:
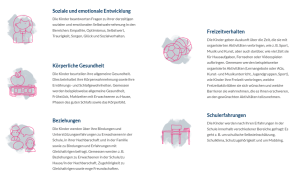
Über alle Befragungen hinweg schälen sich fünf Bedingungen bzw. Ressourcen heraus, die für das Wohlbefinden und damit auch für die Entwicklungschancen der Kinder entscheidend sind:
- Positive Schulerfahrung: Damit ist ein wertschätzender Umgang der Erwachsenen mit den Kindern ebenso wichtig wie Freunde und ein positives, gewaltfreies Schulklima. Dies ist in Deutschland der wichtigste Faktor für das Wohlbefinden.
- Ernährung und Schlaf: Dies sind wichtige Merkmale einer guten Familienkultur, insbesondere das gemeinsame Essen fällt aufgrund von Zeitknappheit häufig weg – ist aber sowohl für das Wohlbefinden als auch ihre Gesundheit der Kinder wichtig.
- Freundschaftliche Beziehungen zu Gleichaltrigen
- Verbundenheit mit Erwachsenen. Dabei geht es um Erwachsene, denen die Kinder wichtig sind. Das sollten natürlich in erster Linie die Eltern sein, Lehrer:innen spielen hier eine ebenso wichtige Rolle. Und auch Nachbarn oder „Leihomas“ können Kinder in ihrem Selbstwertgefühl unterstützen. In Kanada ist dieser Faktor die Nummer 1 bei Befragungen.
- Geschlecht: Anders als in Kanada geht es in Deutschland Mädchen schlechter als Jungen.
- Armut: In Deutschland geht es, ebenfalls anders als in Kanada, armen Kindern schlechter
Auch wenn diese Struktur sich durch alle Befragungen zieht, zeigt sich gleichzeitig: Durchschnitt ist fast nirgends. Und auch Vorurteile und Stereotype werden durch UWE widerlegt. Die Korrelation viele Migranten = viele arme Kinder stimmt in der Hälfte aller Schulen nicht. Es gibt Schulen mit 90 % Einwandererkindern, die zu Hause fast alle Deutsch sprechen. Aber es gibt auch Schulen, in denen die Kinder zu Hause fast alle eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Man findet unter den Kindern mit Migrationshintergrund solche, die schon in jungen Jahren vier Sprachen sprechen ebenso aber Kinder, die weder Deutsch, noch die Muttersprache ihrer Eltern richtig gut beherrschen.
Ob Kinder sich an ihrer Schule wohlfühlen, hat nichts mit dem Migrationsanteil zu tun, sondern mit dem wertschätzenden Umgang der Erwachsenen ihnen gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist es erschreckend, dass im Durchschnitt aller befragten Grundschulen ein drittel der Kinder angab, es gebe in ihrer Schule keine erwachsene Person, der sie wichtig sind. In zwei von 45 Schulen gaben das sogar zwei Drittel der Kinder an.
Erfreulich dagegen: Die statistischen Auswertungen zeigen, dass positive Schulerfahrungen die negativen Wirkungen des Aufwachsens in Armut auf das Wohlbefinden der Kinder mehr als ausgleichen können.
Durch UWE lernen Kinder und Jugendliche, dass ihre Meinung zählt und dass sie ihr Umfeld mitgestalten können. Alle Beteiligten entwickeln gemeinsam Ideen und können Kooperationen aufbauen. Das fördert gelebte Demokratie und ein aktives Miteinander in der Stadt.
Und die Ergebnisse zeigen, es sind nicht unbedingt teure Maßnahmen, die sich aus der Befragung ableiten lassen, auch wenn die bauliche Qualität der Schulen sich natürlich auch auf das Wohlbefinden der Kinder auswirkt. Es sind primär zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Wohlbefinden und die Entwicklung der Kinder maßgeblich prägen. Und diese Beziehungen kosten kein Geld, sondern Einsicht, guten Willen und Sensibilität auf Seiten der Erwachsenen.
Was können Kommunen aus der Befragung lernen:
- Positive Schulerfahrung und insbes. eine gute persönliche Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen an der Schule ist der wichtigste Faktor für Wohlbefinden und Entwicklung. Kinder müssen wertgeschätzt und ermutigt werden. Hier können Kommunen ihre Schulen z.B. durch Schulungsmaßnahmen oder Schulsozialarbeiter unterstützen. Auch sollten Kooperationen mit außerschulischen Akteur:innen gefördert werden.
- Familien sind wichtig. Hier sollten Kinder ihre wichtigsten Bezugspersonen finden. Und hier lernen Kinder im Idealfall, regelmäßig gut zu schlafen und sich gesund zu ernähren. Familien sind angesichts eines sich ständig beschleunigenden Alltags zunehmend überfordert und haben schlichtweg wenig gemeinsame Zeit. Auch hier können Kommunen unterstützten durch Entlastung, Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe. Und Schulen können die Aufklärung zum Thema Gesundheit und Ernährung leisten, die die Familien nicht mehr leisten. Angesichts des demografischen Wandels sind auch „junge Renter:innen“ ein großes Unterstützungspotential. „Leihomas und -opas“ können helfen, schwache Familienstrukturen zu stabilisieren.
- Jedes Kind ist anders und jede Schule ist anders. Was genau an welcher Schule gut ist und was sich ändern muss, kann man nur klären, wenn man die Kinder selbst danach fragt. Die UWE-Befragung füllt eine Lücke, da bisherige Studien keine Analysen zu den lokalen Kontexten erlauben: Kommunen und Schulen können daraus zwar etwas über förderliche Faktoren für das Wohlbefinden und die Entwicklung von Kindern allgemein lernen, sie wissen aber nicht, an welcher Schule oder in welchem Stadtteil welche Probleme wie stark ausgeprägt sind – anders bei UWE.
Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztag werden immer mehr Kinder demnächst einen „Vollzeitjob“ in der Schule machen. Umso wichtiger ist es, dass sie hier unterstützende Rahmenbedingungen vorfinden. Da hilft es nicht, nur mit dem Finger auf die Länder zu zeigen (die für den Unterricht zuständig sind) oder auf den Bund (der diesen Rechtsanspruch eingeführt hat). Den Kindern und unserer Gesellschaft zuliebe sollten Kommunen alles in ihrer Macht Stehende tun, um „ihren“ Kindern ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen.
Falls Sie mehr zum Thema erfahren möchten, empfehle ich den Spiegel-Bestseller “Kinder – Minderheit ohne Schutz“, von El-Mafaalani, Strohmeier, Kurtenbach, der auch dem UWE ein Kapitel gewidmet hat.
Falls Ihr Interesse an UWE geweckt ist, rufen Sie gerne an. Der Verein Familiengerechte Kommune kommt mit UWE dann gerne auch in Ihre Kommune.
Dr. Kirsten Witte
Leiterin des Zentrums für Nachhaltige Kommunen der Bertelsmann Stiftung
Vorsitzende des Vereins Familiengerechte Kommune







Sehr geehrte Frau Witte,
ich wurde auf UWE aufmerksam gemacht. Mit großer Zustimmung habe ich oben gelesen: „Verbundenheit mit Erwachsenen. Dabei geht es um Erwachsene, denen die Kinder wichtig sind. Das sollten natürlich in erster Linie die Eltern sein, Lehrer:innen spielen hier eine ebenso wichtige Rolle. Und auch Nachbarn oder „Leihomas“ können Kinder in ihrem Selbstwertgefühl unterstützen. In Kanada ist dieser Faktor die Nummer 1 bei Befragungen.“ Ich wäre Ihnen verbunden, wenn wir uns austauschen könnten. Hintergrund: unser Mentoringprogramm http://www.balu-und-du.de.de bietet Kindern die Verbundenheit mit jungen Erwachsenen. Meine Frage an Sie ist, wie die BS meinen Verein dabei unterstützen könnte, Multiplikatoren auf unseren Ansatz aufmerksam zu machen. IMit freundlichen Grüßen Dominik Esch, 1. Vorsitzender Balu und Du e.V.